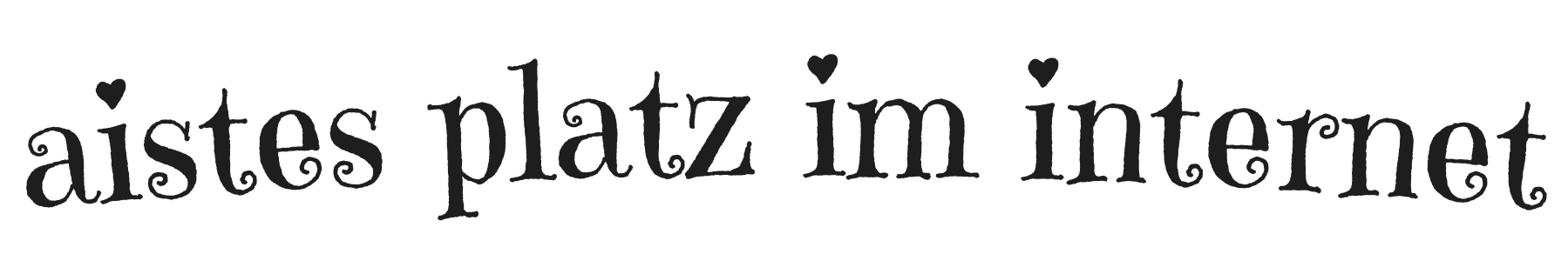Ich mag Urlaubsgeschichten. Das tue ich wirklich. All die Bilder, Erzählungen und Dopaminergüsse, die zusammen mit einem selbstverschuldeten Sonnenbrand mit nach Hause kommen und bei einem «Hey, erzähl mal!» deponiert werden. Ich finde sie spannend und ich höre sie gern.
Nur frage ich mich auch immer wieder, wie viel davon schlussendlich zurückbleibt. Denn die Erfahrung besagt: Egal, wie gut es auch getan hat «dort draussen zu sein und etwas zu tun, das entspannt ja viel mehr als Netflix – voll krass», landet man allerhöchstens zwei grosszügig gerechnete Tage wieder vor der Glotze. Voll krass.
Deshalb habe ich mir vorgenommen, dass ich meine Urlaubsgeschichten zukünftig mit einer halbjährigen Verspätung erzähle. Nur so. Als Experiment, dessen Ergebnis in den nachfolgenden Zeilen zu finden ist: Hier sind 4 Dinge, die mir von meiner zweiwöchigen Reise der spanisch-portugiesischen Künste entlang im Mai 2023 geblieben sind.
Spoiler: Netflix bleibt. Auch weiterhin.
1. Alleinsein ohne Abschottung
Ich bin gut darin, Dinge alleine zu tun. Das war ich schon immer. Obwohl ich mir als Kind immer Gesellschaft gewünscht habe, war es für mich okay, wenn ich keine gehabt habe – ich konnte damit umgehen und ich war gut darin. Worin ich allerdings nie gut war: Alleine Dinge zu tun, die man normalerweise nicht alleine tut. Zum Beispiel sich alleine in ein Restaurant zu setzen. Dann lieber Rückzug. Dorthin, wo es sicher ist.
Die Sache mit dem Essen ist auf Reisen allerdings etwas komplizierter: Grossstädte waren einfach. Madrid und Lissabon sind die Königinnen von diversen Fast-Food-Lokalen – alles schnell, vegan und zum Mitnehmen. Anders sah es allerdings an kleineren Orten aus. Der südländische Lebensstil an der Küste besagt nämlich: Quick and dirty gibt es hier nicht. Die lokalen Restaurants waren schön, voll herzig und… gefüllt mit Einheimischen, hochglücklichen Familien und verliebten Pärchen, die so aussahen, als wären sie gerade einem Hochglanzkatalog für Surfkleidung entsprungen. Und dann war da noch ich. Alleine unterwegs, Hände und Gesicht rot wie eine Tomate und ich könnte schwören, dass irgendwo aus meinem rechten Nasenloch noch leise Sand rausrieselte.
Normalerweise hätte ich mich nie und nimmer mich dort alleine reingesetzt, aber ich hatte keine andere Wahl. Ich konnte froh sein, dass überhaupt etwas geöffnet hatte. Also tat ich es und versteckte mich erstmal fünf Minuten peinlich berührt hinter der Karte – in voller Überzeugung, dass mich alle komisch anstarrten.
Aber das taten sie nicht. Surprise, surprise. Der Abend endete damit, dass ich den beiden britischen Rucksackwandertouristen rechts von mir ihr Essen wegfutterte («Ich mag eh nicht alles alleine!») und der Barkeeper für mich ein neues Cocktail erfand («schmeckt so ähnlich wie ‚Surfer on Acid‘ – ich glaube, der würde dir auch gefallen, hahahahahahaha»).
Und die Reihe setzte sich fort. Je öfter ich gezwungen war, alleine irgendwohin zu gehen, umso mehr lernte ich, dass es einen Unterschied gab zwischen allein-allein und abgeschottet-allein. Irgendwann genoss ich es sogar, mich alleine in ein Restaurant oder eine Beachbar zu setzen und einfach dort zu sein. Manchmal ergaben sich Gespräche, manchmal auch nicht. Aber das war okay. Ich hatte gelernt, alleine zu sein, ohne mich dabei von der Welt abzuschotten, sondern ein Teil davon zu sein.
2. Spontanität
Um meinen inneren Kontrollfreak auf die Probe zu stellen, habe ich beschlossen, nur die Hinreise nach Lissabon zu buchen, ein Hostel für die ersten zwei Nächte und die Rückreise ab Valencia. Der Rest sollte sich spontan ergeben und mich dazu inspirieren, mehr auf mich selbst zu hören und nicht auf im Voraus geschriebene, unverrückbare Pläne. Also ziemlich genau das, was ich am allerwenigsten gut kann und am meisten fürchte. Kontrollverlust.
Natürlich habe ich mir trotzdem einen Plan gemacht. Und der ging auf allen Ebenen schief, die nur schief gehen können. Der eingeplante Bus fuhr ohne mich davon, da sich die Frau am Ticketschalter und der Busfahrer nicht einigen konnten, wer nun für den Verkauf von Bustickets zuständig sei. Der Ort, auf den ich mich so gefreut hatte, war doch nicht so toll wie ich es gedacht hatte, und irgendwann erwischte ich mich, wie ich in halbguter Laune irgendwohin spazierte, wo ich laut meinem Plan gerade sein sollte, obwohl ich absolut keine Lust dazu hatte.
Ich beschloss auf den Plan zu scheissen. Nicht darüber nachzudenken, wo ich in einer Woche sein sollte und mir drei Pläne auszudenken, wie ich dorthin komme und fünf Pläne für den Fall, dass etwas beim ersten Plan schief gehen könnte. Sondern im Moment zu sein und auf mich selbst zu hören.
Irgendwann reichte mein Plan so ziemlich genau einige Stunden in die Zukunft – vor der Reise unvorstellbar und doch eine von den besten Entscheidungen, die ich jemals getroffen habe. Ich checkte morgens aus meinem Airbnb aus und dachte bei einem Kaffee auf der Parkbank darüber nach, auf was ich als nächstes Lust hätte und wohin ich denn heute weiterreisen wollte.
Diese Spontanität führte mich zu Orten, von denen ich nicht mal gewusst habe, dass sie existieren. Sie brachte mich als Beifahrerin in einem mit Surfboards vollgepackten Van einer Surferin, die jede Woche zwischen der Atlantikküste in Portugal und der Mittelmeerküste in Spanien hin und her pendelte («je nachdem wo die Wellen gerade besser sind») und mich spontan mitfahren liess («Du kannst schon mitfahren, aber nur wenn du klein genug bist, du musst nämlich unter mein Longboard passen») – und von dort aus in ein kleines spanisches Dorf an der Küste, das gefühlt noch nie Tourist*innen gesehen hatte und die besten veganen Burger der Welt hatte.
Auf Valencia, von wo aus mein Rückflug gehen sollte, schaffte ich es übrigens auch nicht. Ich musste auf Madrid umbuchen. Aber das war okay. Ich hatte gelernt, dass Spontanität auch Spass macht. Und dass ich keine Angst vor Unvorhersehbarem haben musste – ich war kein Kind mehr und konnte damit umgehen: den Flug umbuchen, die Pläne ändern, mich der Situation anpassen. Und ich schwör, das isch viel geiler als die ganzi ziit alles so mega zplane und zkontrolliere, wüki jetzt.
3. Ich bin alt
Ich finde, ich bin jung. Mein Kopf sagt es mir zumindest immer wieder. Und manchmal laufe ich an anderen jungen Menschen vorbei, in der Illusion, dass ich zu ihnen gehöre, bis mir jemand höflich «Grüezi» sagt. Das ist dann meistens der Moment, wo ich langsam anfange darüber nachzudenken, ob ich mir ein Testament zulegen sollte.
In einem «Social Hostel» in Sevilla fand ich mich auf meiner Reise durch merkwürdige Zufälle in einem Raum voller 18-Jähriger wieder («Ist gerade mein Zwischenjahr nach der Abitur» – «Hey, meins auch!»), die gerade einander am kennenlernen waren. Die Einstiegsfragen lauteten wie folgt:
- «Hey, was wirst du denn jetzt studieren?»
- «Hey, du siehst aus, als hättest du schon mit vielen Frauen geschlafen, also wenn nicht lesbisch, dann zumindest bi, habe ich recht oder nicht?»
- «War deine letzte Beziehung toxisch?»
- «Glaubst du es gibt die wahre Liebe?»
Und obwohl ich mich selbst für einen sehr offenen Menschen halte, konnte ich nicht mitreden. Nicht weil ich keine Antwort gehabt hätte, sondern weil ich feststellte, dass ich bei weitem nicht die gleiche Selbstverständlichkeit an die Nacht legen konnte, wie sie es taten. Eine junge 18-Jährige antwortete auf die Queersein-Frage mit einer sehr selbstverständlichen Erläuterung darüber, was ihr am Sex mit Frauen tatsächlich besser gefällt und an welchen Punkten sie selbst sich noch nicht sicher ist, ob sie sich eher dem bisexuellen oder lesbischen Spektrum einordnen sollte – während ich daneben sass und gerne etwas zum Gespräch beigetragen hätte, aber kein Wort rausbrachte.
Der Abend endete damit, dass die Gruppe von der Hostelleitung in einen Club geführt wurde («Party und gratis Bier»). Das Ergebnis: Ich trank mein Bier und verschwand nach zwanzig Minuten wieder – zurück ins Hostel und zurück in mein Bett. Und das war in Ordnung. So sehr ich mir auch eine Scheibe Mut und Ehrlichkeit von der Gen Z auch abschneiden könnte – das muss weder heute noch morgen sein.
Props an Gen Z an dieser Stelle. Ihr seid so cool wie ich es immer gerne gewesen wäre, aber nie geworden bin.
4. Mich selbst
Ich glaube, wir versuchen viel zu oft, uns in Schubladen zu zwängen, die gar nie für uns bestimmt waren. Und das ist in Ordnung. Es ist eine Mischung zwischen Gewohnheiten, Erziehung, Fremdeinfluss und Lebenserfahrung. Und die reden mit – laut und eindringlich. Aber wir dürfen uns ändern. Wir dürfen uns dafür entscheiden, Dinge anders zu tun als wie wir sie bisher getan haben. Nicht weil wir bisher falsch gewesen wären, sondern weil es vielleicht noch etwas anderes für uns gibt.
Und es existiert dafür nichts Besseres als aus dem gewohnten Umfeld auszubrechen. Denn wenn niemand mehr da ist, um dir zu sagen, wer du sein sollst – vielleicht ist das der Moment, wo man sich selbst wiederfindet.