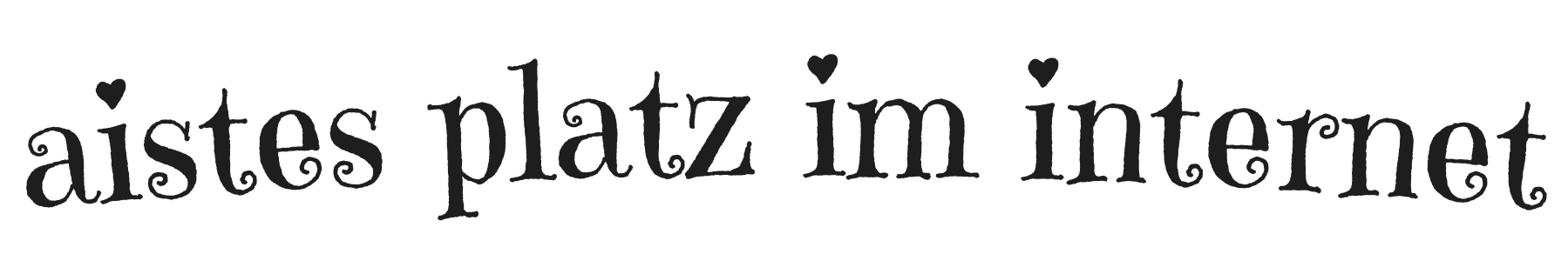«Aber bist du denn nicht wütend?»
Natürlich bin ich es. Irgendwie. Darüber, dass es nicht fair war. Dass Menschen manchmal Kotzbrocken sind. Und darüber, dass ich in einer Welt, die nicht für mich gebaut wurde, niemals eine reelle Chance hatte. Und ich mir nicht einmal mehr selbst sicher bin, ob ich sie überhaupt jemals tatsächlich haben wollte.
«Und mehr nicht? Das wars? Echt jetzt?»
Doch. Vielleicht schon. Was weiss ich. Aber Dinge sind so wie sie sind. Und waren so, wie sie nun mal waren. Welchen Zweck hat es schon, die gleichen Erinnerungen in einer ewigen Schlaufe immer und immer wieder weiterlaufen zu lassen? Sich darüber zu beschweren, was nicht mehr geändert werden kann? Vieleicht gar nie unserer Kontrolle unterlag?
Ich mag es lieber ruhig. Gesunder Pragmatismus, so nennt das mein Kopf. Wir konzentrieren uns auf das, was noch vor uns liegt. Oder jetzt gerade ist. Und machen das Beste daraus. Kontrolliere das, was du kontrollieren kannst – und vergiss den Rest. Scheinwerfer aus. Und wieder ein. Auf das, was zählt.
Vielleicht war ich ja mal wütend. Und bin bei der Erkenntnis angekommen, dass es mich nicht weiterbringt. Dass es uns nicht weiterbringt. Choose your battles – und ich habe gewählt. Die Wahl fiel auf Lösungen.
«Naja.»
Zwei blaue Augen blicken mich skeptisch an. Sie glauben mir nicht.
«Sind es Lösungen? Oder willst du gerade nur nicht hinsehen?»
Diese Augen, das bin ich. Und sie sehen mich.
Wir übernehmen zwar keine Verantwortung für die Handlungen anderer, aber sehr gerne für deren Konsequenzen. Verstecken unsere Wut hinter einer Ansammlung von Esistwieesists und nennen es Vernunft. Oder noch gefährlicher: emotionale Intelligenz.
Auf Verletzung, Respektlosigkeit, Ignoranz, Missachtung von unseren Bedürfnissen oder unserer persönlichen Integrität mit Pragmatismus und Optimismus zu reagieren ist aber weder vernünftig, noch besonders emotional intelligent. Im Gegenteil: Es ist eigentlich sogar ziemlich dumm. Wir nehmen damit nicht nur den Verantwortlichen die Möglichkeit, den Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidungen und Prioritäten zu begegnen, sondern übernehmen auch gleichzeitig ungefragt die Lösung eines Problems, das nicht unseres ist – ohne jemals überhaupt darum gebeten worden zu sein.
Aber wenn die weibliche Sozialisierung kickt, dann kickt sie nun mal richtig. Unsere Angst davor als wütend oder gar vorwurfsvoll zu erscheinen ist so gross, dass wir uns lieber gleich der tauglicheren Variante zuwenden: dem Entschuldigen, ohne jemals eine Entschuldigung oder Erklärung bekommen zu haben.
Wir sind wütend, wir sind frustriert, wir sind traurig. Aber nur für eine Minute. Danach sind wir wieder vernünftig. Verständnisvoll. Realistisch. Angepasst. Reflektiert. So wie wir es sein sollten. Ja nicht zu viel, zu laut, zu schwer, zu kompliziert. Und vorallem auf gar keinen Fall eins: wütend.
Dabei sollten wir es öfters sein. Hässig, vorwurfsvoll, frustriert, laut. Denn: Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen bedeutet nicht leise oder bequem zu sein. Es bedeutet, ehrlich zu sich selbst zu sein und der eigenen emotionalen Wahrheit ein Umfeld zu schaffen, in dem sie produktiv statt destruktiv sein kann.
Gewalt oder Masslosigkeit waren noch nie das Ergebnis von zu viel Wut oder zu viel Freude – sondern die natürliche Folge davon, was passiert, wenn man sich selbst und den eigenen Gefühlen nie einen sicheren Raum geschaffen hat, in dem sie sich entfalten und sicher gefühlt werden können.
Und genauso wie Freude oder Trauer nicht nur sein dürfen, sondern sogar sein müssen und einander bedingen, ist auch die Wut erst dann produktiv, wenn sie sein und bewusst wirken darf. Und vielleicht – nur ganz vielleicht – wenn wir unsere Sozialisierung nur lange genug mit dem Füssen getreten haben, werden wir merken, was sich auf der anderen Seite von Wut und Vorwurf befindet: nämlich Liebe.